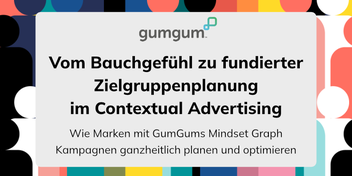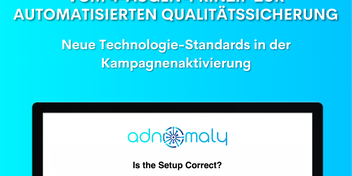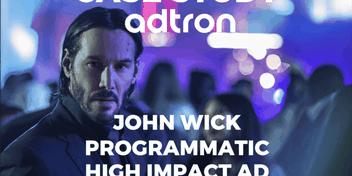Wie man nach einer Übernahme gemeinsame Tech-Strukturen schafft
Anton Priebe, 2. Juli 2025Praxiseinblick von CTO Nils Grabbert, Mrge
 Bild: Miqul – Adobe Stock
Bild: Miqul – Adobe Stock
Konsolidierung ist in der Adtech-Branche keine Seltenheit. Oftmals realisieren Unternehmen ihr Wachstum über Zukäufe. Mit jeder neuen Akquisition müssen unterschiedliche Kulturen, Systeme und Technologien zusammengeführt und in eine gemeinsame Struktur überführt werden. Das stellt nicht nur die jeweiligen Teams vor Herausforderungen, sondern macht auch strategische Entscheidungen auf technologischer Ebene notwendig. Nils Grabbert ist Chief Technology Officer der Unternehmensgruppe Mrge, die in den vergangenen Jahren mehrere spezialisierte Anbieter unter einer gemeinsamen Marke vereint hat. Im Interview erklärt er, nach welchen Kriterien Mrge seine Übernahmekandidaten auswählt, wie Technologieentscheidungen getroffen werden und welche Rolle KI bei der Systemintegration bereits heute spielt.
 Nils Grabbert, Mrge
Nils Grabbert, Mrge
ADZINE: Nils, eure Gruppe vereint inzwischen fünf Unternehmen unter einem Dach. Was genau steckt hinter der Marke Mrge?
Nils Grabbert: Mrge ist eine Plattform für Commerce Advertising. Wir bringen Technologie, Tools und Formate zusammen, um Werbung dort zu platzieren, wo sie wirklich funktioniert. Aktuell vereinen wir fünf Spezialisten unter dem Dach von Mrge: Yieldkit, Digidip, Shopping24, Maxbounty und Sourceknowledge. Angefangen hat das Ganze 2021 mit Yieldkit in Hamburg. Seitdem verfolgen wir mit Waterland im Rücken eine klare Buy-&-Build-Strategie, um gezielt die besten Unternehmen zusammenzubringen.
Jede dieser Firmen bringt eigene technologische Stärken und einen speziellen Kundenstamm mit, sei es im Bereich Coupons oder detaillierter Produktdaten. Damit bieten wir breiten Zugang zu Advertisern, Netzwerken und verschiedenen Monetarisierungsmodellen aus einer Hand.
ADZINE: Ihr habt die Unternehmensgruppe also mit dem Investmentfonds Waterland im Rücken nach dem M&A-Prinzip aufgebaut. Was müssen mögliche Übernahmekandidaten aus technologischer Sicht für euch mitbringen?
Grabbert: Technologie ist ein entscheidender Punkt. Natürlich ist ein funktionierendes Geschäftsmodell die Grundvoraussetzung. Aber wir haben gelernt, dass eine schwache oder veraltete technologische Infrastruktur schnell zum limitierenden Faktor werden kann. Ein veraltetes System kann, wie ich es gerne nenne, eine 'tickende Zeitbombe' sein, die Innovationen blockiert und hohe versteckte Kosten verursacht. Wir bewerten daher immer das Gesamtbild: Passt das Geschäft, wie hoch sind die 'Total Cost of Ownership' der Technologie und welche Risiken birgt sie für die zukünftige Skalierbarkeit? Eine Investition muss sich immer am Geschäftswert messen lassen, aber eine schlechte technologische Basis kann diesen Wert schnell zunichtemachen.
ADZINE: Könntest du das näher erläutern?
Grabbert: Es geht um die Beziehung zwischen Ziel und Werkzeug. Erstrangig ist natürlich der Geschäftswert, den wir für unsere Kunden und das Unternehmen schaffen wollen. Das Business muss funktionieren und skalierbar sein.
Aber die Technologie ist heute das entscheidende strategische Instrument, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen und zu übertreffen. Eine brillante Geschäftsidee ohne die richtige technologische Grundlage kann heute nicht mehr wachsen oder sich verteidigen. Das Business gibt also die Richtung vor, und Technologie ist die Kraft, die uns dorthin bringt.
ADZINE: Gehen wir davon aus, dass das Business von einem Unternehmen funktioniert und ihr habt es übernommen. Jetzt prallen verschiedene Systemlandschaften aufeinander. Welche Herausforderungen ergeben sich dabei, diese Tech-Strukturen zusammenzuführen?
Grabbert: Am Anfang heißt es vor allem: Geduld haben und nicht alles sofort wollen. Das haben wir auch erst lernen müssen. Das Allerwichtigste ist, das Wissen im Unternehmen zu halten. Gerade bei kleineren Teams von 20 bis 70 Leuten kann der Weggang von nur einer Person eine große Lücke reißen. Also gehen wir sehr behutsam vor.
Die erste Phase, die schon mal sechs bis zwölf Monate dauern kann, ist eine Zeit des Verstehens und Vertrauensaufbaus. Wir sichern das Wissen im Team, denn die Leute vor Ort sind der Schlüssel zum Erfolg. Gleichzeitig bringen wir zentrale Kollaborationstools rein, damit alle besser zusammenarbeiten. Parallel schauen wir uns die technische Landschaft genau an, um eine gemeinsame Cloud- und Datenstrategie zu entwickeln und eventuelle Schmerzpunkte zu erkennen. Dieser anfängliche Fokus auf Stabilität ist also kein passives Abwarten, sondern die Grundlage für eine schnelle und effektive Integration in der zweiten Phase.
ADZINE: Was sind solche Schmerzpunkte?
Grabbert: Oft sind es grundlegende Dinge. Ein klassisches Beispiel ist fehlendes Monitoring, bei dem Kunden ein Problem bemerken, bevor wir es tun. Ein anderer häufiger Punkt sind veraltete Abrechnungssysteme. Wenn wir hier modernisieren, können wir unseren Kunden flexiblere Modelle anbieten, was direkt zu mehr Aufträgen und Umsatz führt.
Ein großer Hebel ist auch der Umstieg in die Cloud. Unternehmen, die noch eigene Rechenzentren betreiben, schränken sich oft selbst ein. Die Cloud ermöglicht standardisierte Abläufe und schnelle Skalierung. Ein Ziel ist es zum Beispiel, Daten aus fünf verschiedenen Systemen in einem zentralen Data Warehouse zusammenzuführen, um Redundanzen zu vermeiden und Synergien zu schaffen.
ADZINE: Wie genau fällt eine Entscheidung für oder gegen eine Technologie?
Grabbert: Jede technologische Entscheidung muss mit einer klaren Businessfrage beginnen: 'Was bringt uns das?' Entwickler probieren gerne neue Sachen aus, das ist normal und auch wichtig. Aber entscheidend ist immer, ob eine Neuerung wirklich den Geschäftserfolg steigert. Verbessert sie das Ergebnis, oder ist es nur technisches Spielzeug?
Früher hat man sich manchmal in Technologie verrannt und den Fokus aufs Geschäft verloren. Heute ist das einfacher, weil große Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google uns viel Arbeit abnehmen. Wir müssen nicht mehr alles selbst bauen. Früher haben wir monatelang eigene Machine-Learning-Frameworks programmiert, heute greifen wir auf fertige Umgebungen zurück. Der Fokus liegt heute viel mehr auf dem Produktmanagement, das bei uns eine zentrale Rolle spielt.
ADZINE: Welche Rolle spielt KI bei den Migrationsprozessen aktuell und in Zukunft?
Grabbert: KI ist schon ein tolles Tool, aber kein Allheilmittel. Zum Beispiel kann sie uns bei der Analyse von Code in einer Due-Diligence-Prüfung viel Arbeit abnehmen und ist viel schneller als ein Entwicklerteam. Aber den strategischen Sinn hinter dem Code versteht sie noch nicht. Im Alltag hilft KI uns zum Beispiel, Tests zu schreiben, Code zu verbessern oder Datenbankabfragen zu optimieren. Ein großer Teil des Codes wird heute also schon KI-gestützt generiert, aber eben immer unter menschlicher Anleitung.
Wir hatten zum Beispiel auch die Diskussion, ob wir unsere PHP-basierte Anwendung per KI auf eine moderne Sprache wie Golang umschreiben lassen. Technisch ist das vielleicht machbar, aber wir haben keine Golang-Entwickler, die das Ergebnis validieren könnten. Und genau hier liegt der Punkt: Die Validierung, die Architektur und das strategische Ziel bleiben eine menschliche Aufgabe.
ADZINE: Lass uns zum Abschluss den Blick auf die deutsche Startup-Welt richten. Wie beurteilst du die hiesige Startup-Landschaft? Entsteht viel Innovation in Deutschland?
Grabbert: Für 2025 sehe ich eine starke Konsolidierung bei Themen wie KI und Green Tech. Gleichzeitig stellen neue EU-Regeln wie der AI Act eine Herausforderung dar, weil Compliance aufwändig wird. Die Politik verspricht Bürokratieabbau, aber wie schnell das wirklich kommt, ist noch offen, vor allem bei unsicherer Finanzierung.
Ich glaube, dass es für globale Champions mehr braucht als Geld und Politik. Wir brauchen einen Kulturwandel, mehr Risikobereitschaft und die Akzeptanz, dass Scheitern zum Innovationsprozess dazugehört.
ADZINE: Danke für das Interview, Nils!
Tech Finder Unternehmen im Artikel
EVENT-TIPP ADZINE Live - ADZINE CONNECT Marketing. Tech. Media. 2026 am 26. Februar 2026, 09:30 Uhr
Die Zukunft von OPEN MEDIA zwischen IO, Programmatic, Agentic AI und den Walled Gardens! - Was tun in 2026? Jetzt anmelden!