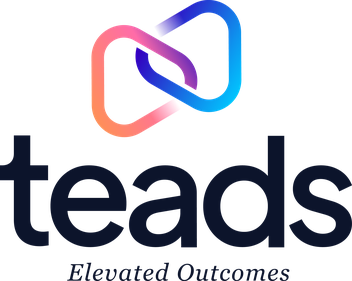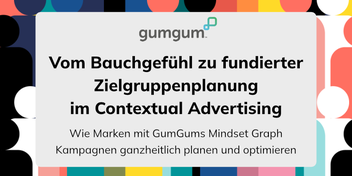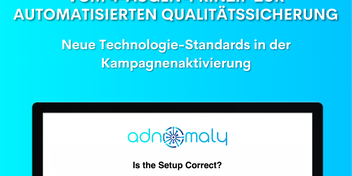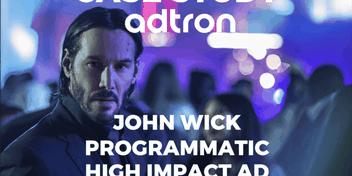Deutsche Meinungsvielfalt unter Druck von Plattformen und KI
Anton Priebe, 10. Juli 2025
Das Expertengremium der Landesmedienanstalten, die KEK, schlägt Alarm. Hinter dem Akronym verbirgt sich die “Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich”. Sie soll die Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk sichern. Im achten Medienkonzentrationsbericht zeigt sie, wie klassische Medien stagnieren, während Plattformen wie Google, Meta und Tiktok weiter an Meinungsmacht gewinnen. Die KEK sieht dringenden Reformbedarf im deutschen Medienkonzentrationsrecht, auch mit Blick auf Künstliche Intelligenz.
Der aktuelle Bericht der KEK zur Medienkonzentration lautet “Social Media, KI & Co. – Neue Gefährdungslagen für die Meinungsvielfalt”. Er beleuchtet eine seit Jahren weitgehend unveränderte Lage auf dem klassischen Fernsehmarkt. So liegt der Marktanteil der RTL-Gruppe konstant bei rund 22 Prozent, gefolgt von der Prosiebensat.1-Gruppe mit etwa 14 Prozent. Die öffentlich-rechtlichen Sender (ARD, ZDF, Dritte) vereinen zusammen über die Hälfte der Zuschauermarktanteile auf sich. Andere private Anbieter kommen auf lediglich knapp 12 Prozent. Im Hörfunk ist die Situation ähnlich stabil, während der Printbereich weiterhin mit rückläufigen Auflagen und Werbeerlösen zu kämpfen hat.
Doch während sich auf den traditionellen Märkten wenig verändert, verschieben sich die tatsächlichen Herausforderungen in Richtung digitaler Plattformen. Die KEK warnt, dass sogenannte Medienintermediäre und große Plattformen – wie Google, Meta, Tiktok und Co. – eine immer zentralere Rolle in der Informationsvermittlung einnehmen. Mit Medien- oder auch Inhalteintermediären sind digitale Dienste gemeint, die Content nicht selbst erstellen, aber maßgeblich auswählen, sortieren, gewichten oder verbreiten. Dank ihres Zugangs zu umfassenden Nutzerdaten und der algorithmischen Distribution der Inhalte können sie die Mediennutzung nachhaltig beeinflussen. Die digitalen Angebote “sind inzwischen nicht nur fester Bestandteil des Informationsrepertoires eines Großteils der Bevölkerung, sie haben diese teilweise bereits überholt”, heißt es.
KI und Plattformen als neue Herausforderungen
Ein Fokusthema des Berichts ist der wachsende Einfluss Künstlicher Intelligenz auf die Informationsverbreitung. So verfügen die Plattformen laut KEK über umfangreiche Datensätze, die ihnen einen Vorteil bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI-Systemen verschaffen. Darunter fällt das Training der Modelle anhand der Nutzerdaten, zu denen die klassischen Medien keinen Zugang haben. Dies verschärfe nicht nur bestehende Marktkonzentrationen, sondern stelle auch die Vielfalt der öffentlichen Meinungsbildung infrage.
Die Digitalisierung und insbesondere der Einsatz generativer KI-Systeme verändern die Medienlandschaft tiefgreifend, erklärt die KEK im Bericht. Dies wirft die Frage auf, ob herkömmliche medienrechtliche Instrumente zur Vielfaltssicherung noch ausreichen, um die Ziele des Medienrechts zu erfüllen. Zu diesen Zielen gehört vor allem die Erhaltung einer unabhängigen Medienlandschaft, um die öffentliche Meinungsbildung zu schützen.
Rolle und Arbeitsweise der KEK
Die KEK ist ein unabhängiges Expertengremium der Landesmedienanstalten. Sie ist im Medienstaatsvertrag verankert, um die Entstehung vorherrschender Meinungsmacht im Fernsehen zu verhindern. Dabei wird auf den Artikel 5 des Grundgesetzes, das “Recht auf Meinungsfreiheit”, Bezug genommen. Die Kommission besteht aus sechs Sachverständigen (davon mindestens drei Richter) sowie sechs Vertreter:innen aus den Landesmedienanstalten, die von den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder berufen werden.
Ihre Aufgabe besteht insbesondere darin, medienrelevante Zusammenschlüsse und Beteiligungsverhältnisse zu prüfen. Sie kommt damit etwa bei Senderzusammenschlüssen, Eigentümerwechseln oder Beteiligungen an Medienunternehmen ins Spiel. Beispielsweise wäre eine Fusion von RTL und Prosiebensat.1 ein Fall für die Kommission.
In ihrer bisherigen Arbeit konzentrierte sich die KEK vor allem auf das lineare Fernsehen. Mit dem neuen Bericht signalisiert sie jedoch die Notwendigkeit, ihre Kompetenzen auszuweiten. Neue Spielfelder sind digitale Plattformen, weitere besagte Inhalteintermediäre oder datengetriebene Geschäftsmodelle. Die zunehmende algorithmische Aussteuerung des Contents sowie der Einfluss von Empfehlungsmechanismen seien aus Sicht der Kommission nicht mehr losgelöst von Fragen der Meinungsmacht zu betrachten.
„Vielfaltsgefährdungen bestehen längst nicht mehr nur im Zusammenhang mit der Veranstaltung von linearem Fernsehen,” erklärt Prof. Dr. Georgios Gounalakis. “Im Zeitalter der Digitalisierung, global agierender digitaler Plattformen und Intermediäre sowie einer deutlich veränderten Mediennutzung kann die KEK im Rahmen ihrer Medienkonzentrationsberichte nicht die Augen vor der Medienwirklichkeit verschließen.“
Reformbedarf im Medienkonzentrationsrecht
Die KEK fordert entsprechend eine grundlegende Reform des deutschen Medienkonzentrationsrechts. Zwar sei das bestehende sogenannte „Sektorenmodell“, das sich auf das Fernsehen fokussiert, über Jahrzehnte ein bewährtes Werkzeug gewesen. Angesichts der Konvergenz von Medien, Inhalten und Plattformen sei es jedoch zunehmend unzureichend. Dieser Gedanke ist allerdings nicht neu. Er wurde schon in den Berichten vor vielen Jahren angedeutet.
Neuen Schwung bekommt das Thema mit dem „European Media Freedom Act“ (EMFA). Er bietet aus Sicht der KEK eine sinnvolle Grundlage für eine erweiterte Regulierung. Dahinter verbirgt sich ein Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene, das medienübergreifende Maßstäbe für die Bewertung von Meinungsmacht aufstellen soll. Nur enthält der EMFA bislang keine unmittelbar durchsetzbaren Sanktionsmechanismen. Die KEK sieht daher die Notwendigkeit, nationale Umsetzungen stärker mit konkreten Befugnissen und wirksamen Eingriffsrechten auszustatten.
Die KEK mahnt also, dass der gegenwärtige rechtliche Rahmen die tatsächlichen Machtverhältnisse in der digitalen Medienwelt nicht mehr adäquat abbildet. Die weitgehende Konzentration von Aufmerksamkeit, Daten und Werbebudgets auf wenige digitale Plattformen gefährde die Pluralität der Informationslandschaft. Mit dem achten Medienkonzentrationsbericht legt die Kommission deshalb eine Bestandsaufnahme vor, die nicht nur als Analyse, sondern auch als politische Handlungsaufforderung zu verstehen ist.
Ob und wie Bund und Länder auf die Empfehlungen der KEK reagieren werden, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die Frage nach der Sicherung medialer Vielfalt die medienpolitische Debatte angesichts der Übermacht der Plattformen und ihren Algorithmen in den kommenden Jahren weiter prägen wird.
EVENT-TIPP ADZINE Live - ADZINE CONNECT Marketing. Tech. Media. 2026 am 26. Februar 2026, 09:30 Uhr
Die Zukunft von OPEN MEDIA zwischen IO, Programmatic, Agentic AI und den Walled Gardens! - Was tun in 2026? Jetzt anmelden!