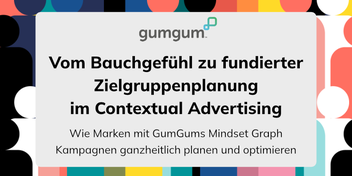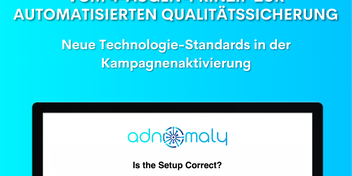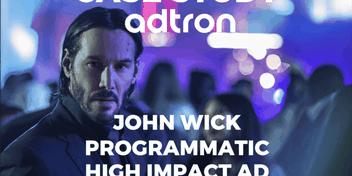Data Collaboration Platforms 2025: Die Architektur ist entscheidend, nicht das Label
Alistair Bastian, 28. Juli 2025
Data Collaboration Platforms haben sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil datengetriebener Strategien entwickelt. In einer Welt, in der Datenschutzanforderungen, technologische Komplexität und steigende Erwartungen an Personalisierung aufeinandertreffen, bieten Data Collaboration Platforms einen adäquaten Lösungsansatz: eine Technologie, mit der Unternehmen ihre Daten analysieren und aktivieren können, ohne sie tatsächlich mit anderen zu teilen. Doch genau hier beginnt die Herausforderung.
Was ursprünglich als technologische Antwort auf die Frage gedacht war, wie Daten genutzt werden können, ohne sie zu teilen, wird heute begrifflich oft inflationär verwendet. Das erschwert es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Im Jahr 2025 ist es deshalb essenziell, zwischen echten technologischen Lösungen und Etikettenpolitik zu unterscheiden.
Begriff und Realität: Data Collaboration Platform ist nicht gleich Data Collaboration Platform
Die ursprüngliche Idee einer Data Collaboration Platform ist simpel: Zwei oder mehr Parteien möchten auf Daten zugreifen oder sie analysieren – ohne diese Daten dabei aus der Hand zu geben. In der Praxis bedeutet das: Daten bleiben lokal, werden nicht verschoben, und die gemeinsame Nutzung erfolgt lediglich auf Basis aggregierter oder anonymisierter Informationen.
In der Realität sieht das oft anders aus. Denn obwohl die Kategorie Data Collaboration Platform an Bedeutung gewonnen hat, fehlt es noch immer an einem klaren, einheitlichen Verständnis davon, was eine solche Plattform tatsächlich leisten sollte. Die Konsequenz: Der Markt wird zunehmend unübersichtlich. Anbieter bezeichnen unterschiedlichste Technologien als Data Collaboration Platform – von simplen Cloud-Umgebungen über zentrale Speicherlösungen bis hin zu echten dezentralen Architekturen. Auch wenn diese Systeme mit Datenschutzversprechen werben, widersprechen sie häufig der eigentlichen Intention von Datensouveränität. Diese konzeptionelle Uneinigkeit führt nicht nur zu Missverständnissen, sondern gefährdet auch die Glaubwürdigkeit einer Technologie, die Vertrauen eigentlich in den Mittelpunkt stellen sollte.
Fünf Merkmale einer modernen Data Collaboration Platform
Nicht jede Plattform, die sich Collaboration Platform nennt, erfüllt die technologischen Anforderungen, die Unternehmen heute an Datensouveränität, Zusammenarbeit und Datenschutz stellen müssen. Fünf Merkmale definieren, was eine echte Data Collaboration Platform im Jahr 2025 ausmacht – und welche Faktoren auf grundlegende Schwächen hinweisen.
1. Datenschutz als Standard – nicht optional
In einer echten Data Collaboration Platform ist Datenschutz nicht konfigurierbar – er ist von Anfang an in die Plattformarchitektur integriert. Das bedeutet: Schutzmechanismen wie rollenbasierte Rechtevergabe, Differential Privacy oder das Non-Movement von Daten greifen automatisch – und lassen sich nicht deaktivieren. Unternehmen müssen sich nicht auf manuelle Einstellungen oder zusätzliche Tools verlassen, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Jeder Analyseprozess erfolgt unter konsequenter Berücksichtigung von Datenschutzprinzipien – verlässlich, revisionssicher und konsistent. Datenschutz ist keine Option, sondern integraler Bestandteil.
2. Technologische Neutralität als Grundlage für Vertrauen
Eine Collaboration Platform sollte Architekturneutralität gewährleisten, die unabhängig von den Besitzverhältnissen ist. Sie sollte keine proprietären IDs, Media-Ökosysteme oder Cloud-Abhängigkeiten vorschreiben, die zu Interessenkonflikten führen können. Diese Neutralität ist essenziell, um echte Data Collaboration zu ermöglichen – auch zwischen Wettbewerbern. Wo technologische Abhängigkeiten bestehen, besteht immer auch das Risiko von Interessenskonflikten. Die Architekturneutralität einer neutralen Collaboration Platform fördert selbst im kompetitiven Kontext kooperative Partnerschaften, da sie sicherstellt, dass Zugriff und Kontrolle von Geschäftsinteressen getrennt sind.
3. Offenheit und Interoperabilität als Voraussetzung für Skalierbarkeit
Damit eine Data Collaboration Platform im Alltag funktioniert, muss sie mit den unterschiedlichsten Systemen, Datenformaten und Identitätsmodellen kompatibel sein – von gehashten E-Mail-Adressen über First-Party-IDs bis hin zu datenschutzfreundlichen Identifiern. Nur wenn diese Vielfalt unterstützt wird, lassen sich kollaborative Prozesse effizient und skalierbar aufbauen. Systeme, die auf proprietäre Frameworks bestehen oder keine Cross-Cloud-Integration ermöglichen, begrenzen das Potenzial gemeinsamer Datennutzung.
4. Dezentralität als Schutzmechanismus
Ein wichtiges Merkmal moderner Collaboration Platforms ist die Vermeidung physischer Datenbewegung. Daten werden nicht hochgeladen, verschoben oder konsolidiert, sondern bleiben sowohl vertraglich als auch physisch beim Data Owner. Diese Architektur schützt nicht nur vor Sicherheitslücken in zentralen Speichersystemen, sondern vereinfacht auch die Einhaltung länderspezifischer Datenschutzgesetze, insbesondere bei internationaler Zusammenarbeit. Wird eine Datenübertragung vorausgesetzt, ist die Plattform per definitionem nicht dezentral.
5. Einsatz mehrschichtiger Privacy-Enhancing-Technologies (PETs)
Eine Collaboration Platform ist keine Einzellösung, sondern ein System aus Schutzebenen. Dazu gehören Technologien wie Differential Privacy zur Vermeidung der Identifizierung von Einzelpersonen, Secure Multi-Party Computation (SMPC) für die gemeinsame Auswertung von Daten mehrere Parteien ohne Offenlegung ihrer Inputs, oder temporäre, synthetische Identitäten, die eine Rückverfolgung verhindern. Entscheidend ist nicht die Existenz einer einzelnen Methode, sondern die Möglichkeit, je nach Anwendungsfall flexibel die passenden PETs zu kombinieren. Plattformen, die ausschließlich auf ein Verfahren setzen oder ihre Mechanismen nicht transparent machen, werden den heutigen Anforderungen nicht gerecht.
Architektur schlägt Label: Wie sich eine echte Collaboration Platform erkennen lässt
Um zu erkennen, ob eine Collaboration-Platform-Lösung wirklich den heutigen Anforderungen entspricht, reicht es nicht aus, auf Produktnamen oder Marketingversprechen zu vertrauen. Stattdessen braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit der konkreten Funktionsweise und Architektur des Systems. Dabei helfen fünf zentrale Leitfragen:
1. Bleiben die Daten wirklich unter meiner Kontrolle?
Eine Collaboration Platform sollte garantieren, dass Daten nicht physisch verschoben, kopiert oder zentral gespeichert werden. Wenn der Anbieter eigene Server oder Cloud-Umgebungen als notwendigen Speicherort definiert, ist Vorsicht geboten.
2. Wie ist die Interaktion mit Partnern:innen geregelt – technisch, nicht nur vertraglich?
Eine starke Collaboration Platform verhindert unautorisierte Zugriffe durch Isolation. Wenn unterschiedliche Parteien in derselben Umgebung agieren oder gemeinsame Analysen unkontrolliert möglich sind, entstehen potenzielle Angriffsflächen.
3. Welche Governance-Funktionalitäten sind standardmäßig integriert?
Wirkungsvolle Systeme bieten nicht nur Reporting, sondern ermöglichen auch die Einschränkung von Queries, die Definition von Datenfreigaben und eine lückenlose Protokollierung. Es reicht nicht, wenn die Kontrolle optional ist – sie muss standardmäßig verankert sein.
4. Welche Schnittstellen und Standards werden unterstützt?
Eine moderne Lösung muss in der Lage sein, mit Identitätslösungen, Analytics-Tools, Measurement-Anbietern und weiteren Infrastrukturkomponenten zusammenzuarbeiten. Je geschlossener das System, desto weniger flexibel ist es in der Praxis.
5. Wie wird sichergestellt, dass Datenschutz nicht durch Nutzerverhalten umgangen werden kann?
Eine Collaboration Platform darf sich nicht darauf verlassen, dass Nutzer:innen sich regelkonform verhalten. Sie muss durch technische Beschränkungen sicherstellen, dass keine personenbezogenen Daten abgerufen, analysiert oder exportiert werden können – auch nicht durch Umwege oder fehlerhafte Abfragen.
Verlässlichkeit entsteht durch Architektur, nicht durch Branding
Data Collaboration Platforms haben das Potenzial, als neutrale Infrastruktur Vertrauen zu schaffen – zwischen Marken, Plattformen, Medienhäusern und Datenanbietern. Sie können helfen, Datenschutzanforderungen einzuhalten, ohne auf datengetriebene Innovation verzichten zu müssen. Doch dieses Potenzial entfaltet sich nur dann, wenn die Technologie den Anspruch erfüllt, auf dem sie aufbaut: Trennung von Kontrolle und Nutzung, Schutz vor Offenlegung, Datenschutz als Standard.
Für Data Collaboration Platforms ist 2025 deshalb ein Jahr der Differenzierung. Die Marktteilnehmer, die echte Datensouveränität technisch umsetzen – und nicht nur versprechen – werden den Unterschied machen. Die anderen riskieren, Vertrauen zu verspielen und mittelfristig den Anschluss zu verlieren.
Eine Collaboration Platform ist keine Black Box. Es ist ein System, dessen Qualität sich nicht im Namen, sondern in der Architektur zeigt.
Tech Finder Unternehmen im Artikel
EVENT-TIPP ADZINE Live - SPOTLIGHT: Geodata Innovation am 19. Februar 2026, 11:30 Uhr - 12:30 Uhr
In dieser SPOTLIGHT-Folge nehmen wir Innovationen rund um Data und Targeting unter die Lupe. Jetzt anmelden!