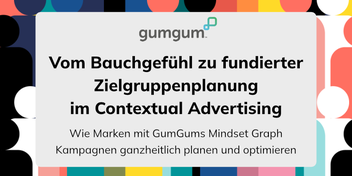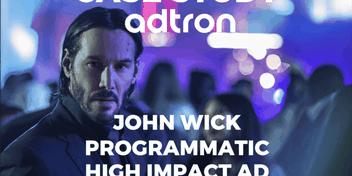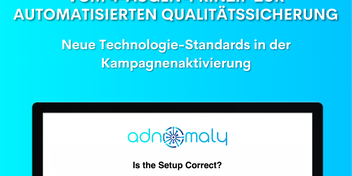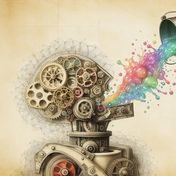KI-Apokalypse: Gibt es in zwei Jahren keine Webseiten mehr?
Ulf Heyden, 24. November 2025Aus der Praxis für die Praxis (2)
 Bild: Paul Königer
Bild: Paul Königer
Die größte Erschütterung im digitalen Publishingsystem steht bevor. Künstliche Intelligenz (KI) kappt den direkten Weg zwischen Inhalt und Nutzer. Antworten entstehen zunehmend dort, wo keine Klicks mehr zurückfließen. Damit gerät ein Geschäftsmodell ins Wanken, das die Reichweitenökonomie über zwei Jahrzehnte getragen hat. Dieser Bruch verspricht einen Neustart sowohl für Publisher als auch für Brands.
In eigener Sache: ADZINE-Kolumnist Ulf Heyden schreibt künftig alle zwei Wochen über Publisher- und Monetarisierungsthemen.
KI verändert die Online-Suche: Typische Suchmaschinen-Fragen wie „Welches E-Bike passt zu mir für 20 Kilometer am Tag und 2.500 Euro Budget?“ beantwortet heute ein KI-Modell wie ChatGPT, Claude oder Gemini in Sekunden – ohne einen einzigen Klick auf eine Website. Die Art, wie wir heute Informationen finden, hat sich grundlegend verändert. Wo früher Suchergebnisse den Einstieg bildeten, entstehen heute erstaunlich hochwertige Antworten direkt in den KI-Systemen. Die klassische Resultatseite (SERP), über Jahrzehnte der wichtigste Garant digitaler Reichweite, verliert an Bedeutung. Die Suche wird zum Dialog, die Antwort zur Endstation – und damit verschiebt sich das Verhältnis zwischen Plattformen und Publishern. Das alte Prinzip „Inhalte gegen Besucher“ trägt nicht mehr verlässlich. KI verarbeitet Inhalte, aber liefert nicht zwingend Nutzer zurück.
Was auf Branchenkonferenzen und in Podcasts wie Datalicious als “KI-Apokalypse" diskutiert wird, bedeutet ökonomische Entkopplung: Die Modelle greifen Inhalte ab, liefern aber nicht mehr sicher Traffic zurück. Das jahrzehntelang stabile Austauschverhältnis im offenen Web ist ins Wanken geraten.
Warum Webseiten ihre Rolle neu finden müssen
Auf LinkedIn entfachte Jonas Frewert jetzt eine vielbeachtete Debatte, ob in zwei Jahren klassische Webseiten weitgehend verschwinden und durch KI-Oberflächen, Personenmarken und Plattformlogiken ersetzt werden könnten. Doch Webseiten verschwinden nicht aus dem digitalen Raum – sie verlieren lediglich an Relevanz als Einstiegspunkt. Nutzer orientieren sich in Feeds, in KI-Oberflächen, in Apps. Erst wenn dort Neugier entsteht, folgt der Schritt auf die Website selbst.
Damit verändert sich der Charakter einer Website. Sie wird zum vertiefenden Ort, zur Instanz für Kontext, für Vertrauen und für alles, was sich nicht komprimieren lässt. Wenn die Besuche seltener werden, müssen sie wertvoller werden. Website-Qualität und Website-Funktion rücken näher zusammen.
Was Publisher jetzt tun müssen
Die größte Herausforderung besteht nicht darin, mehr Inhalte zu produzieren, sondern Inhalte zu schaffen, die den Filter der maschinellen Verdichtung überstehen. Generative Systeme fassen alles zusammen, was sich zusammenfassen lässt. Sie glätten, kürzen und normalisieren – und alles, was austauschbar wirkt, wird austauschbar behandelt. Für Publisher bedeutet das: Nur das, was sich nicht reibungslos in eine generische KI-Antwort falten lässt, bleibt sichtbar, relevant und wertschöpfend. Ein simpler Ratgeberartikel wie „Die 10 besten E-Bikes 2025“ verschwindet sofort im generativen Einheitsbrei.
Daraus entstehen klare Prioritäten. Eine Website darf nicht länger ein Sammlungsort für Loseblattsätze sein, sondern muss zu einer präzise funktionierenden Erfahrungsumgebung werden. Die interne Suche, die in vielen Häusern über Jahre eher ein nachgelagertes Navigationswerkzeug war, wird jetzt zum strategischen Herzstück. Sie muss erkennen, was der Nutzer meint und nicht, was er tippt. Sie muss Inhalte zusammenführen, Querverbindungen sichtbar machen und jenen Moment erzeugen, in dem der Nutzer das Gefühl hat, tatsächlich geführt zu werden – nicht verloren zu gehen. Eine Discovery-Engine, nicht eine Suchleiste.
Dasselbe gilt für Werkzeuge auf der Seite. Tools, Rechner, Konfiguratoren und Vergleichslogiken dürfen keine Ergänzung sein, die man irgendwo „auch noch“ anbietet, sondern müssen dort stehen, wo der Impuls entsteht. Wenn ein Nutzer eine Preisvorstellung eingibt, muss die Antwort sofort berechnet werden, ohne Scrollen, ohne Friktion. Wenn jemand zwei Modelle vergleichen möchte, muss die Tabelle an der Stelle auftauchen, an der die Frage entsteht, nicht mehrere Absätze später. Jede Verzögerung lässt KI attraktiver erscheinen als die Website – Geschwindigkeit ist nicht nur Komfort, sondern entscheidend in der Frage der Profitabilität.
Gleichzeitig braucht es Inhalte, die eine maschinelle Verdichtung nicht beschädigt, sondern aufwertet. Wer E-Bikes nicht nur beschreibt, sondern zerlegt und misst, wer Lieferketten offenlegt, Testmethoden dokumentiert und Unterschiede empirisch nachweist, erzeugt Substanz, die auch nach einer Zusammenfassung noch als Ursprung erkennbar bleibt. Genau diese Form von Tiefe ist das, was KI-Systeme benötigen – und honorieren, um Antworten zu begründen – und was Menschen aufsuchen, wenn sie Gewissheit brauchen.
Solche Inhalte lassen sich nicht kopieren, ohne dass man sieht, woher sie stammen. Sie tragen eine eigene Handschrift: eine klare Methodik, eigene Datenpunkte, überprüfbare Kriterien. Publisher, die das liefern, schaffen nicht nur Relevanz, sondern Verhandlungsmasse – gegenüber Nutzern und gegenüber KI-Modellen. Denn je mehr Originalität in einem Stück steckt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Assistent es zitiert, dass ein Crawler es häufiger nutzt, und dass ein Nutzer danach auf die Website kommt, um tiefer einzusteigen.
Damit entsteht eine neue Form von Sichtbarkeit: nicht mehr durch Masse, sondern durch Evidenz. Die beste Antwort im KI-Zeitalter ist nicht die längste, sondern die überprüfbarste. Eine präzise, sauber belegte Information schlägt eine halbe Seite Marketingtext. Wenn ein Publisher nachweist, wie er testet, misst, vergleicht und bewertet, übernimmt die KI diese Evidenz – und macht die Quelle sichtbar. Publisher müssen also zwei Dinge gleichzeitig leisten – Nutzern Orientierung geben und Maschinen Klarheit. Wer das beherrscht, baut ein Fundament, das auch dann trägt, wenn der erste Kontakt nicht mehr auf der eigenen Seite stattfindet.
Wie Pay per Crawl die Machtbalance verschieben könnte
Auf dem diesjährigen Web Summit in Lissabon hat Cloudflare-CEO Matthew Prince die Idee einer faireren digitalen Ökonomie konkretisiert. Wenn KI-Systeme Inhalte nutzen, ohne Klicks zu erzeugen, sollte die Nutzung vergütet werden. „Pay per Crawl“ ist die nüchterne Bezeichnung, aber dahinter steht eine neue Wertschöpfungslogik: Inhalte werden nicht nur über Werbung monetarisiert, sondern über ihren maschinellen Nutzungswert.
Erstaunlich ist weniger die Idee als die Reaktion des Marktes. Viele KI-Akteure signalisierten Bereitschaft zu Vergütung und Lizenzierung. Nur Google hält bislang am alten Doppelsystem fest, in dem derselbe Crawler für Suche und KI arbeitet. Eine Trennung dieser Funktionen wäre der erste Schritt zu einem transparenteren Modell – und zu einer Einnahmequelle, die Publisher wieder in den Mittelpunkt der Wertschöpfung rückt.
Sollte Pay per Crawl oder ein ähnlicher Mechanismus Branchenstandard werden, entsteht ein völlig neuer Markt: der Markt maschineller Aufmerksamkeit.
Publisher müssen ihre Position systematisch stärken
Operativ müssen Publisher jetzt zwei Ebenen zusammendenken: die inhaltliche und die strukturelle.
Der thematische Fokus – wenige Themen, die man besser erklärt als andere – wird zur Identitätsfrage. Wiedererkennbare Serien, datenbasierte Formate, klare Stimmen und eigene Benchmarks schaffen Verlässlichkeit. Tools verlängern die Sitzung. Eine Community macht aus Reichweite Beziehung.
Auf der technischen Ebene wird Maschinenlesbarkeit zum Qualitätskriterium: strukturierte Daten, saubere Quellen, eindeutige Entitäten, sichtbare Autorenschaft. Nur wer klar auffindbar und korrekt einzuordnen ist, kann langfristig in generativen Antworten bestehen – und in einem Pay-per-Crawl-Modell sinnvoll monetarisieren.
Wie Distribution fragmentiert bleibt und trotzdem steuerbar wird
Die Distribution bleibt fragmentiert, aber beherrschbar: Social dient weiterhin als Entdeckerraum, Newsletter und vor allem der unterschätzte Web-Push werden zum stabilen Rückgrat. Auf Social entsteht der erste Kontakt oft nicht mehr über Links, sondern über Personen und Formate – ein prägnanter LinkedIn-Post erzeugt Aufmerksamkeit, der eigentliche Wert entsteht erst später auf der Seite selbst. Newsletter wirken dabei wie ein Gegenmodell zur KI-getriebenen Verdichtung: Sie schaffen feste Ankerpunkte, hohe Öffnungsraten und wiederkehrende Bindung. Allerdings verlieren Newsletter bei jungen Nutzern zunehmend an Bedeutung. Whatsapp oder Telegram sind hier en Vogue. Web-Push holt Nutzer in einem Moment ab, den keine Plattform garantiert: direkt, situativ und ohne algorithmische Hürde. Richtig eingesetzt schafft er nicht nur Aufmerksamkeit, sondern neue Monetarisierungsflächen – etwa über gesponserte Alerts oder Commerce-Signale.
Für viele Publisher wird Web-Push damit zum unterschätzten Mehrwertkanal, der Nutzer zurückholt, Konversionen ankurbelt und eine stabile, eigene Reichweite aufbaut. Gemeinsam bilden diese Kanäle eine eigene Grundreichweite, eine „Owned Audience“, die die unvermeidliche Volatilität von Social und Search abfedert. So bleibt Distribution trotz Zersplitterung steuerbar – weil Bindung stärker zählt als der einzelne Klick.
KPIs und Kennzahlen ordnen sich komplett neu
Der tiefste Wandel vollzieht sich jedoch in der KPI-Logik. Die alte Ära war optimiert auf Masse: Pageviews, Visits, Unique User. In einer KI-dominierten Landschaft verlieren diese Zahlen ihren Boden. Die erste Interaktion findet oft ohne Website statt – und damit entsteht ein ökonomischer Bruch.
Es entwickeln sich zwei gegensätzliche Modelle. Das geschlossene Modell – Paywall, Registrierungen, blockierte KI-Crawler – setzt auf Wert pro Nutzer. Weniger Reichweite, aber ein Vielfaches an Umsatz pro Kopf. Das offene Modell – Sichtbarkeit, KI-Zugriff, Pay-per-Crawl – baut seinen Wert nicht über Nutzer, sondern über Nutzung auf. Jede menschliche und maschinelle Berührung wird relevant.
Beide Modelle haben ihre Berechtigung, doch sie verlangen jeweils ein eigenes KPI-Set – zwei Philosophien, nicht zwei Taktiken. Das geschlossene Paid-Modell funktioniert nur wirklich stabil, wo eine klare Nische, hoher Nutzen und ausgeprägte Zahlungsbereitschaft zusammentreffen. Für den breiten Markt bleibt es ein Ausnahmeweg.
Wie Marken denselben Wandel wie Publisher spüren
Auch Brands und E-Commerce treffen die Verschiebungen durch KI-Assistenten direkt. Cloudflare-Chef Prince beschrieb auf dem Web Summit, wie sich der Handel verändert, wenn nicht mehr der Nutzer entscheidet, welche Marke er ansieht, sondern ein Agent, der sich ausschließlich an Daten orientiert. Logos, Claims und Kampagnen verlieren in diesem Moment an Einfluss – entscheidend wird, wie sauber, vollständig und eindeutig Produktdaten strukturiert sind. Nur was ein Agent klar versteht, kann er empfehlen.
Prince zeigte das mit dem Beispiel Amazon versus Walmart. Walmart öffnet seine Kataloge bewusst für agentische Systeme und macht den Zugriff leicht, um im Empfehlungsranking weit oben zu landen. Amazon dagegen versucht, den Zugang zu kontrollieren und klagt gegen Modelle wie Perplexity, um seinen Datenvorsprung zu schützen. Zwei entgegengesetzte Strategien, die dasselbe Prinzip verdeutlichen: Wer agententauglich ist, gewinnt Reichweite, auch wenn der Mensch die Marke nie bewusst ansteuert.
Für Marken wird die Website damit seltener Einstiegspunkt, aber wichtiger Validierungsraum. Nutzer kommen, um Sicherheit zu bekommen – zu Rückgaberegeln, Garantien, Passform oder Kompatibilität –, nicht um die Grundentscheidung zu treffen. Gleichzeitig verschiebt sich Attribution: Viele Käufe entstehen ohne sichtbaren Klick, weil die Empfehlung bereits im Assistenten fällt. Wirkung zeigt sich nicht mehr in Klickketten, sondern in Wiederkäufen, Warenkorbumfang und Konsistenz der eigenen Daten. Entscheidend ist damit nicht mehr reine Aufmerksamkeit, sondern Verständlichkeit.
Im KI-Zeitalter gewinnt, wer eindeutig bleibt
Wer in agentischen Systemen klar erkennbar ist, bleibt relevant. KI-Agenten bevorzugen keine Marken – sie nutzen nur das, was sie eindeutig verstehen können. Saubere Produktdaten mit klaren Attributen, Varianten und Verfügbarkeiten gelangen in Empfehlungen, unvollständige oder widersprüchliche Datensätze werden aussortiert, selbst wenn das Produkt besser wäre. Für Publisher gilt das Gleiche: Inhalte mit klaren Entitäten, Autorenschaft, Quellen und nachvollziehbarer Methodik sind für Modelle verwertbar; generischer, unstrukturierter Content verschwindet im Hintergrund. Wer diese Klarheit nicht liefert, verschwindet nicht aus dem Markt – sondern aus den Antworten.
Warum die KI-Apokalypse vor allem ein Perspektivwechsel ist
Was wie ein Verlust wirkt, ist in Wahrheit eine ordnende Kraft. Websites verlieren ihre Rolle als Einstiegspunkt, gewinnen aber an Bedeutung als Ort für Vertrauen, Kontext und Qualität. Pay per Crawl könnte der offenen Strategie erstmals eine stabile ökonomische Basis geben. Paid Content stärkt das geschlossene Modell in der Nische. Beide Wege funktionieren, wenn sie bewusst gewählt und konsistent umgesetzt werden.
Webseiten sterben nicht, sie häuten sich. Damit verändern sie ihre Rolle in der digitalen Welt.
Und wer diese neue Rolle erkennt, wird in einer generativen Welt nicht weniger relevant – sondern besser positioniert als zuvor. Und damit auch langfristig erfolgreich.
EVENT-TIPP ADZINE Live - ADZINE CONNECT Marketing. Tech. Media. 2026 am 26. Februar 2026, 09:30 Uhr
Die Zukunft von OPEN MEDIA zwischen IO, Programmatic, Agentic AI und den Walled Gardens! - Was tun in 2026? Jetzt anmelden!